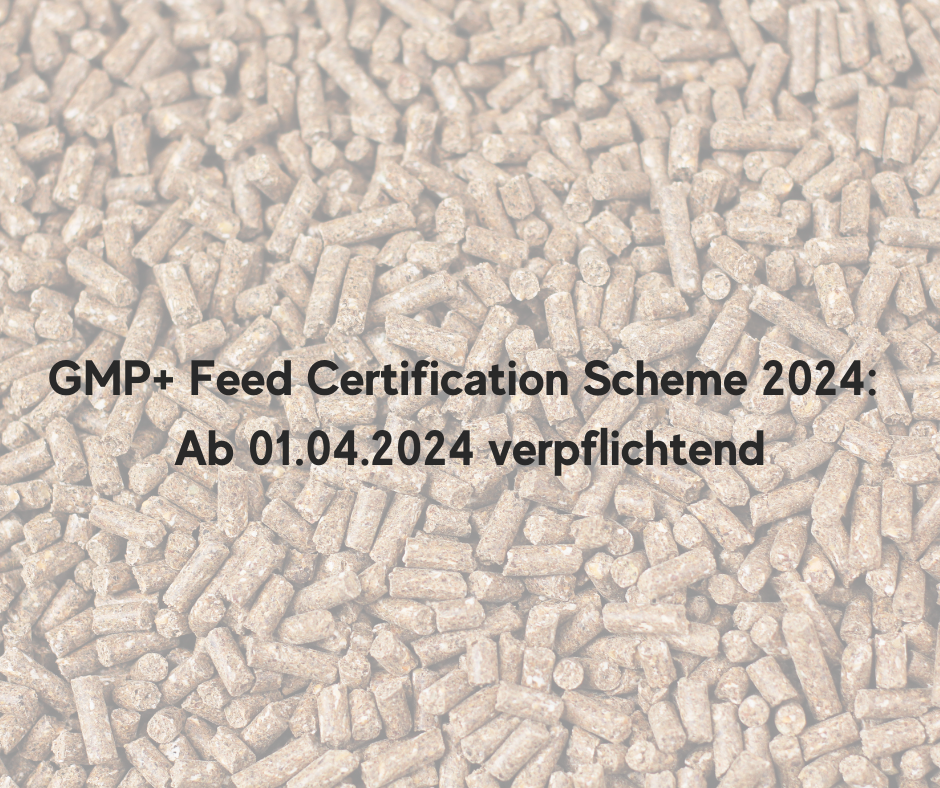Lean & Green Management Award 2024: Nachhaltigkeit und Exzellenz
Sie möchten Ihr Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und Lean Management evaluieren und von Branchenführern lernen? Dann haben wir genau das Richtige für Sie! Der jährlich stattfindende Lean & Green Management Award bietet Ihnen die einzigartige Möglichkeit, Ihre Unternehmenspraktiken zu überprüfen und wertvolles Feedback von Expert/-innen zu erhalten. Das Beste daran? Die Teilnahme ist für Unternehmen mit mindestens 150 Mitarbeiter/-innen kostenlos!
Warum sollten Sie teilnehmen?
Unabhängige Standortbestimmung durch Benchmarking
Erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen im Vergleich zu anderen in Ihrer Branche abschneidet und identifizieren Sie Bereiche, in denen Sie sich verbessern können.
Wertvolle Ideen und Expertenfeedback
Renommierte Universitätspartner unterstützen den Award wissenschaftlich, um sicherzustellen, dass Sie die bestmöglichen Ratschläge und Ideen erhalten, um Ihre Nachhaltigkeits- und Lean-Management-Initiativen voranzutreiben.
Motivation der Belegschaft für Lean & Green Initiative
Die Teilnahme an diesem prestigeträchtigen Award kann Ihre Mitarbeiter/-innen dazu motivieren, sich noch stärker für Nachhaltigkeit und Effizienz einzusetzen.
Vermarktungsvorteile für Produkte und Dienstleistungen
Ein Gewinn oder sogar eine Nominierung für den Lean & Green Management Award kann Ihr Unternehmen als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit positionieren und Ihnen wertvolle Marketingvorteile verschaffen.
Networking beim Lean & Green Summit
Treffen Sie Gleichgesinnte beim Lean & Green Summit, der im Rahmen der Preisverleihung stattfindet. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um wertvolle Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen Unternehmen auszutauschen.
Ablauf des Awards
- Bewerbungsschluss: 30. April 2024
- Assessments und Interviews: Mai bis Juni
- Juryentscheidung: Juli
- Preisverleihung: 7. November 2024
Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung:
Unser engagiertes Team steht Ihnen gerne zur Seite, um Ihre Bewerbung vorzubereiten und sicherzustellen, dass Sie Ihr Bestes präsentieren können. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf, um mehr über die Teilnahme am Lean & Green Management Award 2024 zu erfahren!
Machen Sie den ersten Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigeren und effizienteren Zukunft für Ihr Unternehmen – wir freuen uns darauf, Sie auf dieser Reise zu begleiten!